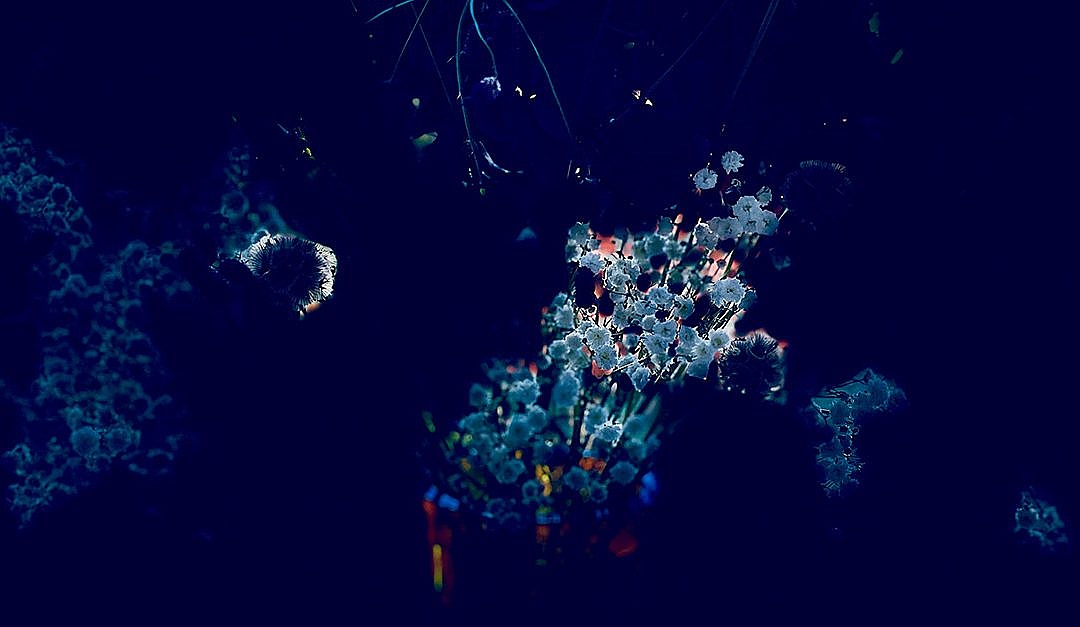Ich durfte den kleinen Jonas am Gemeinschaftsgrab für die Kinder in Zürich drei Monate später verabschieden. 1. und 4. April: er lag also noch drei Tage im Bauch seiner Mutter, bevor er dann am Ostersonntag tot auf die Welt «geholt» wurde. Keine Lebenszeit wird auf dem Grabstein stehen, sondern ein ins Extreme verkürzte Leben.
Das macht sehr betroffen. Wie ins Gespräch darüber kommen, wenn so vieles unerklärlich oder noch ungesagt ist? Wie den Abschied feiern von einem Menschlein, das noch gar nicht «richtig» da war, wie etwas betrauern, von dem vor allem der Vater noch sehr wenig spürte und seinen kleinen Sohn nur von den Ultraschallbildern her kannte.
Verabschieden, was betrauert wurde
Dass die Abschiedsfeier für Jonas aufgrund des Lockdowns so spät nach der Totgeburt stattgefunden hatte, war in diesem Fall für die Eltern sehr hilfreich. Denn man kann nur das verabschieden, was man schon genug betrauert hat. Sonst hätte man das Gefühl Lebendiges zu begraben und sich viel zu früh trennen zu müssen von etwas, was noch tief verbunden ist mit einem selber. Dies kann wiederum im ungünstigsten Fall zu Abspaltungen bzw. Dissoziationen führen.
In meiner Praxis als Trauerredner und Trauerbegleiter gehe ich davon aus, dass sehr viele Abschiedsfeiern, nicht nur die für die Sternenkinder, viel zu früh stattfinden. Die Trauernden sind meist noch gar nicht in der Lage, den Verlust zu be-greifen und sich der «Öffentlichkeit» einer Trauerzeremonie zu stellen.
Abschiedsrituale
Wir haben für Jonas einige Himmelslaternen fliegen lassen (in der Schweiz ist das erlaubt), seine Eltern haben erzählt, wie sehr sie sich auf das Baby gefreut hatten und wie es ihnen in der Schwangerschaft ergangen war. Die Eltern des Vaters haben für ihr erstes Enkelkind eine kleine Spielzeuglokomotive aufgestellt und erzählt, was sie schon für Pläne mit dem Kleinen gehabt hatten. Ich durfte die Abschiedsszene aus dem «Kleinen Prinzen» vorlesen, wir sind still am Grab gestanden, haben kleine bunt bemalte Steine in die Erde gelegt, eine Vertonung von «Eure Kinder sind nicht eure Kinder» von Khalil Gibran gehört, haben geschwiegen, gelacht, geweint, noch ein Gedicht von Patin und Paten gehört. Und: Jonas’ Eltern haben sich am Ende der kleinen Abschiedsfeier versprochen, gut aufeinander zu achten und ihre verschiedenen Wege in der Trauer zu respektieren. Das hatte mich (und wohl alle Trauergäste) sehr berührt. Weil es überraschend war, und gleichzeitig so wichtig für den Trauerprozess!
Ging man vor 30 Jahren noch davon aus, dass es für die Eltern das Beste sei, ein tot geborenes Kind schnell zu vergessen (und es deswegen nicht mehr anzusehen!), so ist heute bekannt, dass Trauerreaktionen nach dem Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft oder nach der Geburt vergleichbar sind mit solchen nach anderen schweren Verlusten, und dass das Abschiednehmen vom Baby eine wesentliche Voraussetzung für das „Gelingen“ der Trauer ist.
Frauen und Männer trauern auf verschiedene Weise
Trotz der großen individuellen Variabilität des Trauerverlaufs gibt es auch zahlreiche Hinweise darauf, dass sich Männer und Frauen hinsichtlich ihrer Copingstrategien des Verlusts voneinander unterscheiden. Das kann zu einer Belastung für die Partnerschaft führen. Während Frauen das Bedürfnis haben, über den Tod ihres Kindes zu sprechen, fällt es vielen Männern schwer, ihre Gefühle auszudrücken. Diese neigen eher dazu, den Verlust des Kindes zu verleugnen oder sich durch ein erhöhtes Arbeitsengagement abzulenken, was wiederum zu Fehlinterpretationen der Frauen führen kann. Diese sehen in der Zurückhaltung ihres Partners, über den Verlust zu sprechen, oft mangelnde Emotionalität und Empathie. Viele Männer hingegen fühlen sich aufgrund der größeren Intensität und längeren Dauer der Trauerreaktionen ihrer Partnerinnen verunsichert. Um sie nicht zusätzlich zu belasten, versuchen sie, ihre eigenen Gefühle zu kontrollieren.
Wofür uns in allen Sprachen die Worte fehlen
Beiden, den Müttern und den Vätern, ist aber eine Aufgabe gemeinsam: den Verlust zu betrauern, das Kind zu verabschieden, das Leben weiterhin zu bewältigen oder als Eltern nach wie vor präsent zu sein, wenn es noch Geschwister des gestorbenen Kindes gibt. Und irgendwie Worte und Rituale zu finden, für das, wofür uns eigentlich in allen Sprachen der Welt die Worte fehlen.
„Ein Mann, der seine Frau verliert, wird Witwer genannt, eine Frau, dessen Mann stirbt, ist eine Witwe. Kinder, die ihre Eltern verlieren, heißen Waisen. Wie aber heißen Eltern, die ein Kind verloren haben?“ – so fragt sich der holländische Autor P. F. Thomese ein seiner biografischen Erzählung Schattenkind.
In diesem Sinne haben die Eltern des kleinen Jonas etwas sehr Wesentliches gemacht: ihren Schmerz benannt, ihn mit den engsten und liebsten Menschen gefeiert, sich somit der mittragenden Gemeinschaft von Familien und Freunden versichert. Und sie haben als verwaiste Eltern ihrem Baby und ihrem eigenen, sich unterschiedlich zeigenden Schmerz in der Trauer den gebührenden Platz eingeräumt, damit das Leben trotz und in allem wieder gut weitergehen darf.
Das tote Menschlein war Felix, neununddreißig Zentimeter, die Augenhöhlen waren noch leer, er hat das Licht der Welt erblickt, wie man sagt, mit leeren Augenhöhlen. Lag ausgebreitet nackt vor uns, konnte nichts sehen, nichts hören. Oder war seine Seele in ihm schon erwacht? (…)
Ich versuchte mit Felix zu reden, hatte plötzlich das Gefühl, er würde seinen Kopf drehen, sich mir zuwenden und Papa sagen. Papa, komm! Oder: Papa, was machen wir heute? Wenn man ein Kind hat, das niemals Papa sagen kann, ist es dann ein richtiges Kind oder ein amputiertes Kind? Oder ist es ein Kind, das vergessen hat, woher es gekommen war? Nein, Felix in der Krippe, das hatte keinen Sinn. Ich wollte ihn lebend, mit lockigem Haar. Ich wollte ihn wachsen sehen, raufen, lachen, rennen, staunen, lernen, und wieder wachsen. Ich wollte mit ihm Papierflieger bauen…
(Zitat: Wolfgang Weigand, Sterbelos, Königshausen & Neumann, Würzburg 2016)
Wolfgang Weigand, freischaffender Theologe und Autor, CH-Winterthur
www.abschiedsfeiern.ch www.schritte.ch