Anonymität und Individualität im Grabbrauchtum
Nicht weit vom Strand von Santa Monica liegt im Stadtteil Westwood von Los Angeles, rings umgeben von Hochhäusern und vielbefahrenen Straßen, als eine beschauliche Oase der Stille der Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary. Hollywood ist nur wenige Kilometer entfernt, und so findet man dort die letzte Ruhestätte nicht weniger bekannter Größen aus dem Film- und Showgeschäft. Ebenfalls ganz in der Nähe liegt die Universität von Kalifornien, und so beschloss ich, hier wie schon in anderen Städten die freie Zeit auf einer Fachtagung für einen Friedhof-Besuch zu nutzen.
Sollte ich den Friedhof mit nur drei Adjektiven beschreiben, würde ich sagen: ruhig, gepflegt und weitläufig. Immer wieder spenden hohe Bäume den Besuchern Schatten, und die einzelnen Grablegen sind zumeist durch breite Wege, mitunter ausgedehnte Rasenflächen und akkurat gestutzte Hecken voneinander abgegrenzt. Der Friedhof wurde 1905 als Sunset Cemetery gegründet. Die weitaus meisten Gräber stammen daher aus dem zwanzigsten Jahrhundert, und so fehlen hier die mitunter gewaltigen Unterschiede in den äußeren Abmessungen und im materiellen Aufwand der einzelnen Grabdenkmäler, die manche historisch gewachsenen europäischen Friedhöfe in europäischen Großstädten kennzeichnen. Deutlich weniger ausgeprägt als auf vielen älteren Begräbnisplätzen erschien mir auch die Verbreitung christlicher Symbole, wie sie in der Errichtung steinerner Kreuze, aber auch in der Verwendung von Bibelzitaten oder der Darstellung von Engeln und Ölzweigen als Ausdruck der christlichen Erlösungs- und Jenseitshoffnung zum Ausdruck kommt.
Unverkennbar war indessen der hohe Wert, den man durchweg der individuellen Kennzeichnung der einzelnen Grabstellen beigelegt hatte – wenn auch in höchst unterschiedlicher Weise. „H. L.“ lautete in kaum überbietbarer Kürze die Inschrift auf einer kleinen quadratischen Steinplatte, welche die Identität der hier beigesetzten Person nur dem bereits kundigen Besucher offenbarte. Sehr viel häufiger war dagegen die Kennzeichnung mit vollem Namen, Geburts- und Sterbejahr: „TRUMAN CAPOTE 1924–1984“ und „MARILYN MONROE 1926–1962“ lauteten die Inschriften auf den dazugehörigen Urnengräbern. Dass man in dem zuletzt genannten Fall den Künstlernamen statt des eigentlichen Namens der Verstorbenen verwendet hatte, zeigt wohl nicht zuletzt, in welchem Umfang die reale Person durch die von ihr verkörperte Leinwandpersönlichkeit auf Dauer in den Hintergrund gedrängt worden war. Relativ selten fühlten sich Verstorbene oder Hinterbliebene dazu gedrängt, den Status, die bleibende Bedeutung oder irgendwelche herausragenden Leistungen der hier beigesetzten Berühmtheiten zu dokumentieren – vielleicht vertraute man darauf, dass sie ohnehin allseits bekannt seien. Den wohl originellsten, ebenso augenzwinkernden wie hintergründigen Hinweis auf die Scheinwelt des Kinos zeigte der gleich einer Kinoleinwand rechteckige Grabstein des Komödianten Jack Lemmon, auf dem ganz lapidar nach der Art eines Spielfilmvorspanns zu lesen stand:
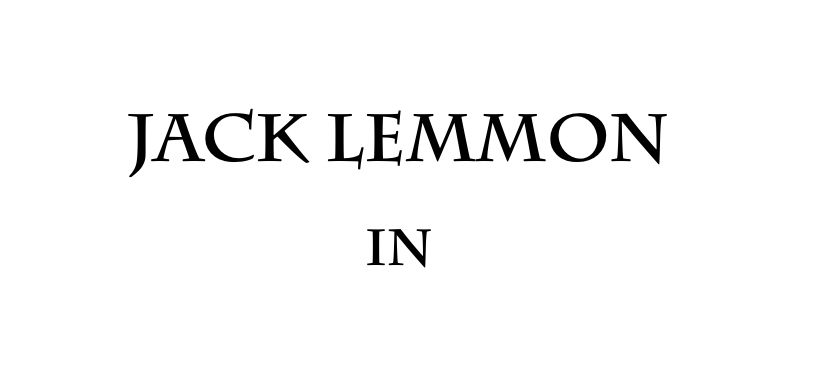
„Ja, wir wissen tatsächlich nicht, wo er jetzt drin ist“, lachte die Ehefrau eines amerikanischen Kollegen, der ich davon erzählte. Vergleicht man die hier beschriebenen Gräber mit solchen des achtzehnten oder neunzehnten Jahrhunderts, etwa auf dem Pariser Cimetière du Père Lachaise oder dem Alten Friedhof in Bonn, erahnt man die beträchtliche Entwicklung, die der Umgang mit Tod und Trauer in nur zweihundert Jahren genommen hat. Die Kennzeichnung der Gräber mit den Namen der Verstorbenen folgt nach wie vor einem lange etablierten christlichen Brauch, doch der Gedanke eines Weiterlebens oder Wiedersehens nach dem Tod bleibt heute oft unausgesprochen oder im Ungefähren. Wie es die Inschrift auf dem Grabstein des Musikers Ray Conniff mit den bekannten Anfangsworten eines seiner erfolgreichsten Lieder ausdrückte: Somewhere, my love … Die Vorstellung eines Besuchs am Grab als Ausdruck der Sorge um das Seelenheil der Verstorbenen schien hier überlagert oder ersetzt durch die Idee eines Besuchs als Gelegenheit zum zwanglosen, stillen Dialog, der nicht zuletzt der Selbstreflexion dient. Oder wie es die Inschrift auf einer Marmorbank formulierte, die wohl das dort beigesetzte Ehepaar gestiftet hatte:
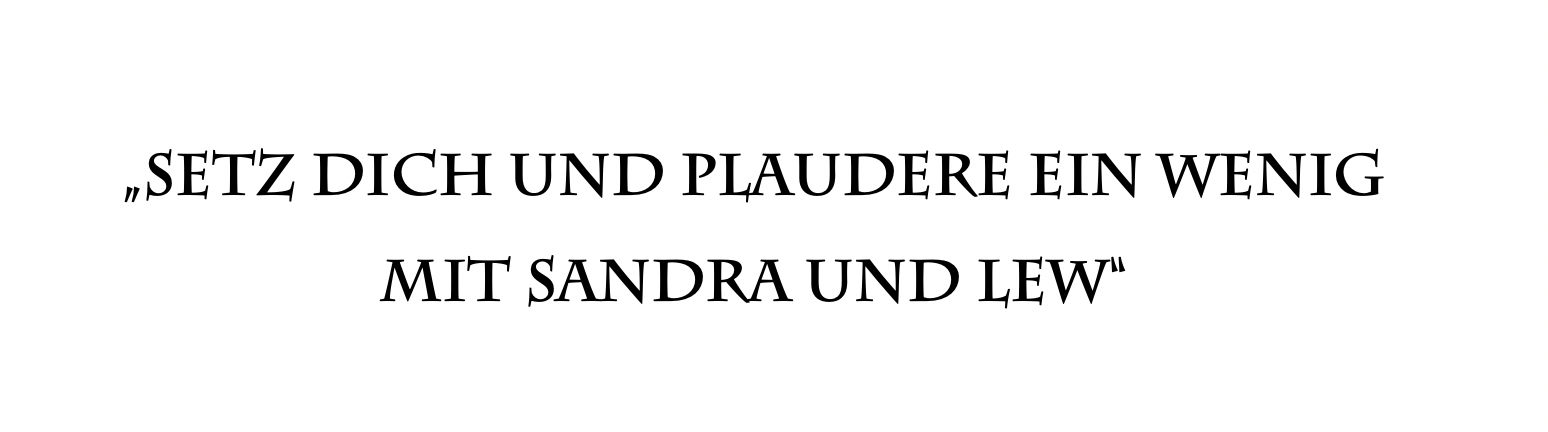
(Sit down and have a chat with Sandra & Lew).
Individuelle Kennzeichnung hat in unserem hauptsächlich vom Christentum geprägten Bestattungswesen eine lange Tradition, und eine anonyme Bestattung blieb in der bürgerlichen Gesellschaft oft den Außenseitern vorbehalten. „Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet“, heißt es noch am Ende von Goethes Werther – ein dezenter Hinweis des Autors auf den weithin geübten kirchlichen Brauch, ‚Selbstmördern‘ ein christliches Begräbnis zu verweigern. Lange Zeit sorgten auch staatliche Gesetze auf diesem Gebiet für eine gewisse Einheitlichkeit, die oft nicht weiter hinterfragt wurde. „Catherine hatte einmal gesagt, dass man ihre Asche von einem Berg in den Wind streuen sollte“, bemerkt der Off-Erzähler ganz am Ende des Films Jules und Jim, um dann mit unterschwelligem Bedauern hinzuzufügen, „aber das war verboten.“ Erst in der jüngsten Vergangenheit findet man mit dem Ruhe-, Begräbnis- oder Bestattungswald eine Alternative zum traditionellen Friedhof. Die Gründe für ihr Auftreten und ihre Akzeptanz können im Einzelfall zweifellos sehr unterschiedlich sein. Eine gewichtige Rolle spielt aber wohl immer wieder die fortschreitende Säkularisierung und der Rückgang kirchlicher Bindungen, sowie die Attraktivität der Vorstellung eines ewigen Kreislaufs und der Wunsch nach Naturverbundenheit, in einem Zeitalter verbreiteter Zivilisationskritik. Mitunter mag wohl auch der Wunsch mitspielen, die Hinterbliebenen von der Pflicht der Grabpflege zu befreien, ihnen also ‚nicht zur Last zu fallen‘ – was dann freilich auch ein Aufsuchen des Grabs aus anderen Gründen auf Dauer unmöglich macht.
An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht anzumerken, dass eine Spannung zwischen Individualität und Anonymität auch in der außerchristlichen Religionsgeschichte weit verbreitet ist. „Den Scheiterhaufen überladen sie nicht mit Tüchern und Duftstoffen“, schrieb der römische Historiker Tacitus im ersten Jahrhundert n. Chr. über die Germanen, „doch jedem werden seine Waffen und manchen auch das Pferd ins Feuer mitgegeben.“ Noch zur Zeit Karls des Großen galt die Leichenverbrennung als typisch heidnische Sitte, so dass man sie den eben erst unterworfenen und zum Christentum bekehrten Sachsen unter Androhung der Todesstrafe verbot. Auch Grabbeigaben galten als typisch heidnisch, weshalb sie nach der Christianisierung schon bald fast vollständig verschwanden. Ganz anders als bei den von Tacitus beschriebenen Germanen war dagegen der Umgang mit den Toten in weiten Teilen der Jungsteinzeit und Bronzezeit. Noch heute weithin sichtbar ist dies bei den vielen Grabhügeln, die man zu jener Zeit rings um die Kultstätte Stonehenge in Südwestengland anlegte. Sie sind zwar durch ihre Lage und Monumentalität klar von ihrer Umgebung abgegrenzt, doch tritt der Einzelne hier fast stets hinter das Kollektiv zurück und bleibt – mit wenigen Ausnahmen – vollständig anonym.
Was folgt aus solchen religionsgeschichtlichen Vergleichen, die sich beliebig vermehren und verfeinern ließen? Auf der einen Seite ist zu betonen, dass sich der Mensch in dem hier beschriebenen Zeitraum nicht mehr wesentlich verändert hat, dass also seine geistigen Fähigkeiten und seine Wahrnehmung der Umwelt von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart gleichgeblieben sind. Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, dass der Umgang mit Tod und Bestattung innerhalb dieses Zeitraums eine enorme Bandbreite aufweist: Was in einer früheren Epoche selbstverständlich erschien, kann auf uns Heutige höchst befremdlich und mitunter gar bizarr wirken – wie man dies ja auch aus den Beschreibungen von Bestattungssitten indigener Kulturen durch neuzeitliche Ethnologen kennt. Fragt man nach den Konstanten jenseits aller kulturellen Prägungen, ist vielleicht als erstes auf die weite Verbreitung des Gedankens einer Gemeinschaft der Lebenden und der Toten hinzuweisen: Die Lebenden bestimmen ihre eigene Identität immer auch durch die Erinnerung an die Verstorbenen. Nicht von ungefähr weisen daher Gräberfelder, Begräbnisplätze und Friedhöfe schon in der Vor- und Frühgeschichte eine beträchtliche, manchmal Jahrhunderte währende Kontinuität auf. Dieser Umstand verweist zugleich auf die weite Verbreitung einer weiteren Konstante:

Mitunter braucht sie auch Handlungen, die je nach der Stärke kollektiver Bindungen den Charakter von Ritualen annehmen können. Die heute zugelassene Vielfalt ermöglicht es in jedem Einzelfall, aus ganz unterschiedlichen Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen. Individuelle Lebensumstände sowie unterschiedliche religiöse und kulturelle Prägungen können darüber entscheiden, welchen Ausdruck der Gedanke einer Verbundenheit der Lebenden mit den Toten annimmt.
Prof. Dr. Bernhard Maier studierte Vergleichende Religionswissenschaft, Sprachwissenschaft, Keltische Philologie und Semitistik. 1998 habilitierte er sich an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zum Thema: Die Religion der Kelten: Götter, Mythen, Weltbild. Er ist Autor vieler Publikationen.




